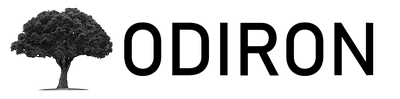Mit der “Quelle des Rechts” wurde eine neue Videoserie gestartet. Den Gegenstand der Rechtswissenschaft richtig zu wählen, also aus der richtigen Quelle Recht abzuleiten, sollte für jeden Juristen das höchste Ziel sein. In der Vergangenheit stellte es sich aber als schwierig heraus, die richtige Quelle zu finden. Die Rechtspositivisten meinten letztendlich, dass es keine überstaatlichen Rechtsquellen gebe, dass man sie so und so nicht falsch wählen könne und entschieden sich daher zu guter Letzt für das “staatliche Recht”, als ihre Rechtsquelle.
Mit dem Ersten Video der Reihe wird folgenden Fragen nachgegangen:
Was ist eine Rechtsquelle?
Welche Rechtsquellen gibt es?
Kann man eine Rechtsquelle falsch wählen?
Hat die moderne Rechtswissenschaft den falschen Gegenstand gewählt?
Was ist eine Rechtsquelle? Darunter versteht man Bereiche, oder eben Quellen, aus denen verbindliche Regeln für das menschliche Verhalten abgeleitet werden. Abhängig davon in welchen Rechtskreisen man sich bewegt, unterscheiden sich auch die Rechtsquellen. Das können etwa im Case-Law richterliche Entscheidungen sein, im positiven Recht rechtsstaatliche Gesetze oder Verordnungen, im Naturrecht die Vernunft oder natürliche Vorgänge die in der Natur beobachtet werden, bei Religionen zum Beispiel Heilige Schriften oder im Vertragsrecht, beziehungsweise im Völkerrecht, die übereinstimmenden Willenserklärungen der Vertragsparteien. Wir sehen also, es gibt eine ganze Menge an Rechtsquellen.
Die Aufgabe der Juristen ist es, die Rechtsquellen richtig zu erkennen, zu interpretieren und auf das alltägliche Geschehen anzuwenden. Und jetzt kommt die Frage: Ist es egal welche Quelle man für die Ableitung von Recht verwendet oder kann man die Quelle des Rechts und damit den Gegenstand der Rechtswissenschaften auch falsch wählen. Damit werden wir uns heute beschäftigen.
Als Einleitung zu diesem Thema beginnen wir mit einer kleinen Geschichte:
Stellen sie sich vor, sie arbeiten gerade zu Hause an ihrem Computer und bekämen plötzlich Schmerzen in ihrer Brust. Augenblicklich greifen sie zum Telefon und rufen den Arzt ihres Vertrauens an. Dieser ist gerade in seiner Ordination tätig und meint, dass ihre Angaben sehr besorgniserregend klingen würden und er unverzüglich eine Untersuchung vornehmen müsse, um eine sichere Diagnose stellen zu können. Zu ihrer Verwunderung meinte der Arzt aber weiter, sie sollten sich zu Hause kurz hinlegen er würde in ein paar Minuten wieder zurückrufen. Tatsächlich, etwa 15 Minuten später ruft der Arzt zurück und meint mit ruhiger Stimme: “Machen sie sich keine Sorgen, es handelt sich bloß um einen eingewachsenen Zehennagel.”
Während das Ziehen und die Schmerzen in ihrer Brust allmählich unerträglich werden, fragen sie ihn wie er darauf komme. Daraufhin meinte der Arzt: Wird durften für die Untersuchung keine Zeit verlieren, daher erachtete er es als zweckmäßig, sofort einen Patienten aus seinem Wartezimmer zu sich herein zu holen und zu untersuchen, da Sie ja nicht gleich greifbar gewesen wären. Er könne Sie beruhigen, so der Arzt weiter, das EKG und das Ultraschall im Brustbereich blieben ohne Befund und da der untersuchte Patient einen eingewachsenen Zehennagel hatte, ist anzunehmen, dass die Schmerzen von diesem herrühren. Sie Fragen ihren Arzt durch die Blume ob er noch alle Tassen im Schrank hätte und ob diese Diagnose sein Ernst sei. Darauf meinte er erbost, was ihnen wohl einfallen würde, seine Arbeit in Frage zu stellen. Er habe die Untersuchung nach den neuesten medizinisch technischen Erkenntnissen und Methoden vorgenommen und die Ergebnisse halten jeder wissenschaftlichen Überprüfung stand. Sie bräuchten sich keine Sorgen zu machen.
Stellen wir uns weiter vor, sie würden daraufhin einem Herzinfarkt erliegen. Der Arzt verstünde die Welt nicht mehr. Wie könne man bloß in einem eingewachsenen Zehennagel sterben? Die Diagnose müsse aber richtig sein, denn schließlich habe er wissenschaftlich gearbeitet. Sicher, zu ähnlich unschönen Ergebnissen hätten seine Behandlungen in der Vergangenheit immer wieder mal geführt, aber damit müsse man in seinem Job einfach rechnen. Um aber trotzdem zu verhindern, dass sich solche Fälle in Zukunft weiterhin zutragen, beschließt er eine ergänzende Methode einzuführen. Nämlich, sollte in Zukunft jemand mit Schmerzen in der Brust anrufen, verzichtet er gleich vorweg auf seine sofortige wissenschaftliche Befundaufnahme, sondern schickt den Anrufer gleich ins Krankenhaus.
So, das war unsere kleine Geschichte. Und was sagen sie? Fühlen sie sich bei diesem Arzt gut aufgehoben? Nein? Warum? Er hat doch nach den neuesten wissenschaftlichen Methoden gearbeitet. Also wo ist der Haken? Ach ja richtig. Der Untersuchungsgegenstand wurde falsch gewählt. Aber was bedeutet das für alle daran anknüpfenden wissenschaftlichen Erkenntnisse? Ja genau. Sie führen zu einem falschen Ergebnis. Glauben sie, dass es in wissenschaftlichen Disziplinen so etwas tatsächlich gibt? Was hat das alles mit der Rechtswissenschaft zu tun? Aber auch mit anderen Geisteswissenschaften. Ein dem Rechtspositivismus nahestehender Professor schrieb in einem seiner Werke, dass man einen Erkenntnisgegenstand niemals richtig oder falsch wählen könne, sondern bloß zweckmäßig oder unzweckmäßig. Als Beispiel gab er unter anderem an, dass es sinnvoll sein könne Augen wissenschaftlich zu untersuchen, weniger zweckmäßig wäre es aber, nur linke oder nur rechte Augen zu untersuchen. Ich würde eher sagen: Wenn ich die Funktionsweise eines Auges untersuchen möchte und hierfür als Erkenntnisgegenstand die Billardkugeln in einem Berliner Café heranziehe, werden sich die wissenschaftlichen Erkenntnisse über menschliche Augen durchaus in Grenzen halten. In unserem Beispiel war es zweckmäßig, sofort eine Untersuchung durchzuführen. Der Erkenntnisgegenstand, also der Patient aus dem Warteraum, war aber völlig falsch gewählt, und das war für jedermann leicht erkennbar. Wie kommt man also darauf, dass man den wissenschaftlichen Gegenstand nicht falsch wählen könne, wo doch das Gegenteil so offensichtlich ist?
Die konsequenten Rechtspositivsten wählen das staatliche Recht aus zweckmäßigkeitsgründen, nicht weil der Gegenstand richtig ist. Zweckmäßig ist er deshalb, weil das staatliche Recht mit Zwang durchgesetzt wird. Damit können Juristen ihre Aufgaben erfüllen, nämlich Recht mit wissenschaftlichen Methoden abzuarbeiten und im Alltag anzuwenden. So wie unser Arzt, der sich weil es schnell gehen musste, einfach irgendeinen Patienten aus dem Warteraum holt, wählen die Rechtspositivsten einfach das Staatsrecht, weil es gewaltsam durchgesetzt wird.
In unserem Beispiel arbeitete der Arzt mit wissenschaftlichen Methoden an den falschen Patienten. Weil dadurch immer wieder Patienten sterben, führte er eine völlig unwissenschaftliche Methode ein. Eine Art Notbremse, um Kollateralschäden zu vermeiden. Also, wann immer jemand wegen Brustschmerzen anrufen sollte, schickte er diesen ganz einfach ins Krankenhaus. Die anderen, leichten Fälle, behandelt er aber weiterhin falsch. Das kennen wir auch aus der Rechtswissenschaft. Nach dem zweiten Weltkrieg war für jedermann, der einen Funken Gerechtigkeitssinn hatte, erkennbar, dass die Rechtsordnungen von Staaten absolutes Unrecht sein konnten. Also mit Recht überhaupt nichts mehr zu tun haben. Aber, statt zu erkennen, dass man einen falschen rechtswissenschaftlichen Gegenstand gewählt hatte, ging man so vor wie unser Arzt. Man zog ganz einfach eine philosophische Notbremse ein, die sogenannte Radbruchsche Formel. Diese geht auf den ehemaligen deutschen Juristen und Politiker Gustav Radbruch zurück. Er meinte, dass der Rechtspositivismus den Juristen im Dritten Reich wehrlos gemacht habe. Seine Formel besagten nun sinngemäß, dass ein Gesetz seinen Rechtscharakter dann verlieren würde, wenn es unerträglich ungerecht sei. Damit versuchte er zukünftige staatliche Kollateralschäden zu vermeiden. Das hat überhaupt nichts mehr mit Wissenschaft zu tun, denn diese Formel ist eine systemwidrige überstaatliche Regel die außerhalb des gewählten wissenschaftlichen Gegenstand steht und die sich Gustav Radbruch ganz einfach aus der Nase gezogen hat. Als willkürliche menschliche Regel hat diese auch überhaupt nichts mit Naturrecht zu tun. Man wollte aber, aus welchem Grund auch immer, nicht zugeben, dass die sogenannte moderne Rechtswissenschaft einen völlig falschen Gegenstand gewählt hatte. Stattdessen zog man einfach eine willkürlich formulierte Formel hinzu und betrachtete dies als den großen Wurf. Würden sie im obigen Beispiel unseren Arzt als den absoluten medizinischen Helden feiern, nur weil er die Kollateralschäden in seiner Ordination reduzieren konnte? Eher nicht, oder? Weil man aber in der Rechtswissenschaft keine Ahnung hat was der richtige wissenschaftliche Gegenstand ist, sind hier solche Blindflüge und Eiertänze durchaus normal. Oder man wählt absichtlich einen falschen Gegenstand?
Wie dem auch sei, das war ein kleiner Ausflug zum Thema: Kann man einen wissenschaftlichen Gegenstand falsch wählen? Die Antwort lautet: Ja das kann man! Und die Rechtswissenschaften haben ihren wissenschaftlichen Gegenstand für jedermann leicht erkennbar völlig falsch gewählt. Wenn Sie wissen wollen wie man den rechts aber auch den bildungswissenschaftlichen Gegenstand richtig wählt, dann darf ich Ihnen mein Buch empfehlen: ODIRON steht für: „Objectively Discernible Rules Of Nature“ also die objektiv erkennbaren Regeln der Natur. Für Rechtswissenschaftler gibt es auch eine Überraschung, nämlich die Metamorphose der Rechtswissenschaft, von der von Willkür geprägten Geisteswissenschaft zur objektiven und reproduzierbaren Naturwissenschaft.