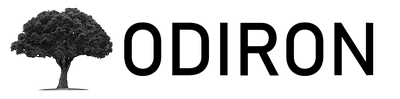In dieser zweiteiligen Videoserie geht es um die Begriffe Moral, Sitte, Recht und Naturrecht. In Teil 1 werden die von der herrschenden Rechtslehre vertretenen Begriffsdefinitionen näher erläutert und mit einem Beispiel veranschaulicht, in Teil 2 beleuchten wir die Widersprüche und die wissenschaftlichen Mängel in der Begriffsfindung und in den rechtswissenschaftlichen Lehren.
Heute geht es um die Begriffe: Moral, Sitte, Recht und Naturrecht. Zunächst vorweg es gibt zu diesen Begriffen unterschiedliche Zugänge. Da es sich dabei um Begriffe handelt die nichts Wahrnehmbares umschreiben gibt es bei ihrer Definition auch relativ starke Unterschiede. Was bedeutet das? Nehmen wir zum Beispiel den Begriff “Mensch”. Jeder von uns hat ein genaues Bild darüber was einen Menschen ausmacht, zeigt man auf einen Elefanten und sagt: „Das ist ein Mensch!“, dann wissen wir gleich dass dieser lügt oder einen an der Waffel hat. Das ist bei den geisteswissenschaftlichen Begriffen nicht der Fall. Hier ist es tatsächlich so, dass Begriffe wie Bildung, Ethik, Moral oder Recht in den Raum geworfen werden und jeder kann sich selbst aussuchen was man darunter verstehen könnte. Grundsätzlich kann uns das ja egal sein, sofern wir uns nicht wissenschaftlich damit befassen. Es ist aber dann nicht egal, wenn an solchen Begrifflichkeiten ganz besondere Folgen geknüpft sind. Was kann das sein? Wenn man etwa die Bildungsbegriffe wie Allgemeinbildung oder Berufsbildung zu weit fasst, könnte dies bedeuten dass die Schulpflicht oder die Ausbildung für Berufe bzw Studien eben länger oder kürzer dauern. Menschen könnten also durch die bloße Definition von abstrakten Begriffen zu einem bestimmten Verhalten verpflichtet werden. Das gleiche gilt für den Rechtsbegriff. Auch der ist als geisteswissenschaftliche Schöpfung an keine faktischen Kriterien gebunden. Die Folge ist, dass jeder glaubt man könne alles als Recht bezeichnen was man nur möchte. Eine Staatsführung könnte einen durchdachten Verfassungsentwurf ebenso zur Grundlage einer Rechtsordnung auserkoren wie eine Heilige Schrift – und das ist in einigen Staaten schon Realität geworden – oder vielleicht die Greenpeace-Statuten, die Harry-Potter-Bände oder vielleicht bloß die irren Gedanken irgendeines durchgeknallten Diktators. All das könnte man als Rechtsquelle wählen. So viel zunächst einmal zur Einstimmung in die Materie ich werde die Behandlung dieses Themas in zwei Videos aufteilen. Im ersten Video werden wir uns ansehen wie diese Begriffe aus der Sicht der Rechtswissenschaft bzw der Rechtsphilosophie ausgestaltet sind und ich werde versuchen die Abgrenzungen anhand eines Beispiels näher zu verdeutlichen. Im zweiten Video befassen wir uns mit den Schwachstellen und Widersprüchen dieser Begriffsdefinitionen. Ich werde Ihnen erklären warum sie falsch gewählt wurden und warum allein daraus erkennbar ist, dass die dahinter stehenden rechtswissenschaftlichen Lehrern als unrichtig entlarvt werden können. Kommen wir aber zunächst zu Teil 1 zu den Begriffsdefinitionen.
Moral: Unter Moral versteht man die persönliche Einstellung eines Individuums zu Richtig oder Falsch, Gut oder Böse. Es handelt sich also um die individuelle Stellungnahme zum eigenen Verhalten aber auch zu dem anderer Menschen sowie zu deren Sichtweisen und Ideologien. Aus rechtsphilosophischer Sicht wird also die innere Pflicht bzw die innere Überzeugung, die sogenannte Moralität, von der äußeren Pflicht, der Legalität, unterschieden. Ein anderer philosophischer Zugang ist es die Moral oder Moralen, weil es ja unterschiedliche Moralsysteme gibt, als Normensysteme zu bezeichnen, welche menschliches Verhalten mit unbedingter Gültigkeit Regeln. Diese unterschiedlichen Normensysteme und ihre Eigenheiten zu ergründen ist allenfalls die Aufgabe eines Philosophen, nicht aber eines Juristen. Dieser sucht ja nach Recht und damit nach der “einen” verbindlichen Rechtsordnung denn, diese ist der Gegenstand der Rechtswissenschaften. Daher ist der philosophische Moralbegriff vom rechtswissenschaftlichen zu trennen. Kommen wir zur Sitte: unter Sitte versteht man jene Regeln des sozialen Zusammenlebens, die sich aus den Erwartungen der Gemeinschaft schöpfen. Man erwartet von den Gemeinschaftsmitgliedern, aber auch von allen Menschen die in dieser Gemeinschaft leben wollen, dass Sie sich den Sitten anpassen bzw unterordnen. Diese Sitten und Bräuche sind ortstypisch und werden für ein friedliches und geordnetes Miteinander als notwendig erachtet. Die Erwartungshaltungen entstehen äußerlich durch gewohntes traditionelles Verhalten und innerlich durch die übereinstimmenden Ideologien und Moralverstellungen der Gemeinschaftsmitglieder. Nach der bei uns herrschenden rechtswissenschaftlichen Ansicht gelten diese sittlichen Regeln nicht als Recht, sie können aber mit dem Status eine sogenannten “Gewohnheitsrechts” einen Rechtscharakter erlangen, wenn diese Sitten drei Voraussetzungen erfüllen: Erstens ein Zeitfaktor, dass heißt die Verhaltenspraxis muss über einen längeren Zeitraum hinweg andauern. Das Zweite ist die Rechtsüberzeugung die “opinio juris”. Diese liegt vor, wenn die Gemeinschaftsmitglieder davon überzeugt sind, dass dieses Verhalten auch rechten sei. Und drittens muss ein Verweis im positiven Recht also im geschriebenen Recht vorliegen, dass das Gewohnheitsrecht als Rechtsquelle anerkannt wird. Somit sind wir beim Recht angelangt. Als “Recht” bezeichnet die bei uns herrschende Lehre die Summe jener Verhaltensanweisungen, die staatlich organisierten Zwang auslösen, sobald man gegen diese Anordnungen verstößt. Damit umfasst eine Rechtsordnung all jene Regeln für deren Durchsetzung der Stadt verantwortlich ist. Dieser Begriff grenzt den Gegenstand der Rechtswissenschaft ganz klar von anderen Ordnungssystemen ab. Moral und Sitte werden vom Recht getrennt was natürlich auch bedeutet, dass eine Rechtsordnung keine moralischen Erwartungshaltungen erfüllen muss, sondern völlig frei gestaltet werden kann. Warum aber wählen die Rechtspositivisten einen Rechtsbegriff der von moralischen Werten losgelöst ist? Ganz einfach, sie gehen vom Werterelativismus aus, dass heißt ein absolut gültiges Richtig oder Falsch gibt es nicht, universelles Recht also Naturrecht könne – so ihre Auffassung, nicht bewiesen werden und um wissenschaftlich und methodisch arbeiten zu können, trennt man daher das Recht von jeder moralischen Voreingenommenheit.
Damit wurde das Naturrecht angesprochen und somit kommen wir schon zum Naturrecht. Anders als die Rechtspositivisten gehen die Verfechter des Naturrechts davon aus, dass Recht sehr wohl bestimmte moralische Standards erfüllen müssen. Es gibt allerdings keinen einheitlichen Naturrechtsbegriff, der unterscheidet sich je nach ideologischem Zugang. Es gibt aber Eckpfeiler die einen Naturrechtsbegriff ausmachen und die sehen wir uns jetzt näher an. Beim Naturrecht wird von einem „Sein“ auf ein „Sollen“ geschlossen. Das bedeutet, der moralische Anspruch ist bereits in den natürlichen Tatsachen vorhanden und bräuchte nurmehr mittels Vernunft erkannt und abgeleitet werden. Diesen moralischen Ansprüchen komme absolute Gültigkeit zu, das heißt sie würden immer und überall auch verbindlich sein. Aus dieser Verbindlichkeit ergibt sich die Einheit von Recht und Moral, da auch der staatliche Gesetzgeber an diese Naturgesetze gebunden ist. Naturrecht wurde in der Vergangenheit aus der Natur des Menschen, aus der Vernunft oder zum Beispiel aus dem Willen Gottes abgeleitet. Wie weit diese Quellen aber mit der Ansicht kompatibel sind, dass beim Naturrecht von einem „Sein“ auf ein „Sollen“ geschlossen wird, werden wir uns im zweiten Video dann noch näher ansehen. Am Beispiel eines Autokaufs werde ich die Begriffe nun näher erklären. Der Verkäufer „V“ verkauft dem Käufer „K“ ein Auto wobei V, also der Verkäufer, verschweigt, dass der Wagen einen Motorschaden aufweist. Wenn wir den Fall von der Moral her betrachten sind wir von vorhersehbaren Ergebnissen weit entfernt, denn jedes einzelne Individuum hat einen eigenen Zugang zum Sachverhalt. So wird der Käufer die Handlung als moralisch verwerflich betrachten, weil er einen Kaufpreis bezahlt hat der dem Wert des Autos tatsächlich nicht entspricht. Er wird im Käufer Betrugsabsicht vorwerfen. Der Verkäufer könnte dem wiederum entgegnen, dass er selbst Opfer eines Betruges und somit Geschädigter sei und durch den Verkauf er sich nur schadlos halten wollte. So gesehen wäre er selbst Opfer und somit das Geschäft für ihn moralisch jedenfalls in Ordnung.
Anhand dieser Reaktionen kann man erkennen, dass moralische Wertungen subjektiv sind und keineswegs dem allgemeinen Gerechtigkeitsempfinden entsprechen müssen. Betrachtet man den Sachverhalt von der Sitte her, so sind die Gewohnheiten und Bräuche der jeweiligen Gemeinschaft maßgeblich. Ob man den Vorgang persönlich in Ordnung oder verwerflich findet, spielt hier keine Rolle. Gibt es ein Entscheidungsgremium welches über die Feststellung bzw. über die Einhaltung der Sitten und Gebräuche wacht, so entscheidet dieses Gremium unabhängig davon, was die einzelnen Mitglieder moralisch für richtig halten. Wie der Sachverhalt zu beurteilen ist, entscheiden daher die vorherrschenden Sitten. Ist es üblich, dass der Käufer vor dem Kauf die Ware besser begutachtet, frei nach dem Motto: „Augen auf, Kauf ist Kauf“, wird wohl der Kaufvertrag gültig zustande gekommen sein. Sind die Sitten und Gebräuche eher auf den Käuferschutz aus und gegen betrügerische Handlungen, so sind die Ungültigkeitserklärung des Vertrages und die Bestrafung des Verkäufers ebenso möglich. Kommen wir nun zum Recht. Hier vergleicht man die jeweiligen Handlungen, also den Verkauf des Autos, mit den gesetzlichen Bestimmungen. Was die einzelnen Menschen moralisch davon halten oder die Sitten und Gebräuche der Community zu sagen haben, ist egal. In den deutschsprachigen Rechtskreisen gibt es ein sogenanntes Strafrecht, welches Strafen bei Betrugshandlungen vorsieht. Aber auch zivilrechtliche Regeln, wie die Möglichkeit zur Anfechtung des Vertrages und Schadensersatz, sind in unseren gesetzlichen Bestimmungen durchaus vorhanden. Der entscheidende Unterschied zu Moral und Sitte ist beim Recht aber die Loslösung vom Willen des Einzelnen oder denen einer Gemeinschaft. Ein abstraktes Wesen, nämlich der Staat, gibt die Regeln vor. Diese Regeln werden demnach auch nicht vom Betrogenen selbst oder von einer entrüsteten Gemeinschaft durchgesetzt, sondern von den fiktiven bzw. abstrakten Organen des Staates. Das sind üblicherweise die Polizeibehörden, die Staatsanwaltschaften, die Gerichte und so weiter. Da die Staaten als abstrakte Wesen bei der Erlassung ihrer Gesetze weder an sittliche noch an moralische Werte gebunden sind, besteht permanent die reelle Gefahr, dass sie ihre Gestaltungsmöglichkeiten bis zum Unerträglichen ausnützen. Bei unserem Autokauf könnte der Staat etwa als gesetzliche Strafe für Betrugshandlungen von einer Geldstrafe über eine Haftstrafe bis hin zur Steinigung oder zur Vierteilung alles verhängen. Um das Ausufern der staatlichen Willkür im Zaum zu halten, wurde und wird von manchen Rechtsgelehrten das Naturrecht herangezogen. Dieses sei, so ihre Verfechter, über dem staatlichen Recht angesiedelt. Als modernes Beispiel für solch eine regulierend eingreifende naturrechtliche Regel gilt die „Radbruchsche Formel“. Diese besagt sinngemäß, dass ein staatliches Gesetz dann seine Verbindlichkeit verlieren würde, wenn es eine zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit beinhalten würde. So entschieden Tribunale, also Gerichte, dass etwa die Verbrechen der Nationalsozialisten oder die Mauerschüsse der DDR gegen dieses über dem Gesetz stehende Naturrecht verstoßen würden. Nach der herrschenden Lehre greift das Naturrecht aber erst in Extremfällen ein. Banale Alltagsereignisse, wie die eines Autokaufs selbst, stellen daher keinen Grund dar, die staatliche Gesetzgebung zu korrigieren oder zu ergänzen. Soweit zu den typischen Begriffsfindungen und Abgrenzungen. Kritische Beobachter werden allerdings bereits bemerkt haben, dass bei den Begriffsdefinitionen irgendetwas nicht stimmen kann. Wo die Probleme liegen und warum diese Definitionen rechtstheoretisch zum Teil absolut fragwürdig sind, schauen wir uns in Teil 2 näher an.