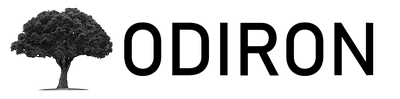In diesem Beitrag widme ich mich einer der jüngsten Fehlentwicklungen in der Philosophiegeschichte. Auch wenn die Lehren von Hume (die Trennung von Sein und Sollen) und Moore (der Naturalistische Fehlschluss) die logische Konsequenz daraus waren, dass Gelehrte zuvor Naturrecht aus Fiktionen statt aus Fakten ableiteten, so zogen sie trotzdem daraus die falschen Schlüsse. Hume und Moore gingen nun davon aus, dass Recht mit unserem natürlichen Umfeld überhaupt nichts zu tun hätte und bloß die menschliche Moral als einzige Quelle des Rechts in Frage komme. Wie die beiden darauf kommen und warum es sich dabei um einen “naturalistischen Fehlsch(l)uss in den Ofen” handelt, erkläre ich in diesem Video.
Kennen Sie das? Sie werden in der Schule oder auf einer Universität mit wissenschaftlichen Lehren konfrontiert, welche die Professoren mit einer derartigen Selbstsicherheit vortragen, so dass man gar nicht auf die Idee kommen könnte, dass diese vorgetragenen Philosophien schon vom Ansatz weg völlig falsch gedacht wurden. Mir ist das vor langer Zeit passiert als ich das erste Mal mit dem naturalistischen Fehlschluss von David Hume und Edward Moore konfrontiert wurde. Schon damals wusste ich, dass diese Lehren völlig an der Realität vorbeigehen. Heute möchte ich euch an meinen Erkenntnissen teilhaben lassen und euch erklären, warum diese Lehren nichts anderes sind als ein naturalistischer Fehlschuss in den Ofen.
Hallo und herzlich willkommen bei ODIRON. Ich heiße Wolfgang Matthäus Bach. Der Grund für das heutige Video liegt eindeutig auf der Hand: ich vertrete beweisbares Naturrecht und die Verfechter des naturalistischen Fehlschlusses glauben tatsächlich, dass man aus natürlichen Tatsachen keine Regeln ableiten könne. Das hört sich ungefähr so an:
“Das Argument vom naturalistischen Fehlschluss hat weitreichende Folgen über die Ethik hinaus. Beispielsweise spielt es eine Rolle bei dem Versuch aus einer biologischen Bestimmung der Natur des Menschen Werte oder Normen für menschliche Verhaltensweisen abzuleiten. Es klingt so, als würde das nur selten Geschehen. Fatalerweise wird der Fehler aber immer und immer wieder gemacht.” (Quelle: Gerd Scobel auf https://www.youtube.com/watch?v=R2mOmL7D7HQ)
“Fangen wir an mit dem naturalistischen Fehlschluss. […] “Denn wer so ein Fehlschluss begeht macht nach Auffassung vieler Philosophen ein Anfängerfehler! Den darf man nicht machen die naturalistischen Fehlschluss.” […] “Entsprechend ist dann auch die Frage: wer sollte diesen dummen Fehler begehen? Der grundsätzliche Gedanke hinter diesem Konzept ist: aus bloßen Fakten Folgen keine Normen, aus bloßen Tatsachenbehauptungen Folgen keine Werturteile, aus bloßen Indikativen Folgen keine Imperative, aus bloßen Seins-Aussagen Folgen keine Sollens-Aussagen, man spricht auch vom Sein-Sollen-Fehlschluss.” (Quelle: Dietmar Hübner auf https://www.youtube.com/watch?v=zt1V-MC4PeY&t=33s)
Unabhängig davon wie Gerd Skobel oder Dietmar Hübner persönlich zum naturalistischen Fehlschluss stehen, kann man schon sehr gut erkennen, dass man als Naturrechtler, nach der Ansicht vieler Philosophen, sehr schlechte Karten hat. Nun schauen wir uns aber an, worauf sich ihre Annahme stützt. Die Philosophie der Trennung von Sein und Sollen geht auf ein Werk von David Hume zurück. Im “Traktat über die menschliche Natur” konkret über die “Moral” findet sich folgende Textpassage:
“Ich kann nicht umhin diesen Betrachtungen eine Bemerkung hinzuzufügen, der man vielleicht einige Wichtigkeit nicht absprechen wird. In jedem Moralsystem das mir bisher vorkam habe ich immer bemerkt, dass der Verfasser eine Zeitlang in der gewöhnlichen Betrachtungsweise vorgeht, das Dasein Gottes feststellt oder Beobachtungen über menschliche Dinge vorbringt, plötzlich werde ich damit überrascht, dass mir anstatt der üblichen Verbindungen von Worten mit ‘ist’ und ‘ist nicht’, kein Satz mehr begegnet indem nicht ein ‘sollte’ oder ‘sollte nicht’ sich fände. Dieser Wechsel vollzieht sich unmerklich, aber er ist von größter Wichtigkeit. Dies ‘sollte’ oder ‘sollte nicht’ drückt eine neue Beziehung oder Behauptung aus, muss also notwendigerweise beachtet und erklärt werden. Gleichzeitig muss ein Grund eingegeben werden, für etwas, das sonst ganz unbegreiflich scheint, nämlich dafür wie diese neue Beziehung zurückgeführt werden kann, auf andere, die von ihr ganz verschieden sind. Da die Schriftsteller diese Vorsicht meistens nicht gebrauchen, so erlaube ich mir sie meinen Lesern zu empfehlen. Ich bin überzeugt, dass dieser kleine Akt der Aufmerksamkeit, alle gewöhnlichen Moralsysteme umwerfen und zeigen würde, dass die Unterscheidung von Laster und Tugend, nicht auf der bloßen Beziehung der Gegenstände begründet ist und nicht durch die Vernunft erkannt wird.” (Quelle: David Hume in Traktat über die menschliche Natur)
Wenn wir uns den Text ansehen dann fallen mehrere Dinge sofort auf. Hume kritisiert also, dass Schriftsteller Tatsachen behaupten und daraufhin Regeln aufstellen und nicht erklären wie sie von den Tatsachen, also dem Sein auf die Regeln, also dem Sollen, kommen. Weil Schriftsteller in der Vergangenheit offenbar zu wenig erklärt haben, wie sie von ihren Seins-Beschreibungen Regeln ableiten, schließt nun Hume daraus, dass in der Natur so und so kein Ordnungssystem bestehen würde. Damit stellt er aber plötzlich eine eigenständige Behauptung auf, die mit diesem Erklärungsbedürfnis allein gar nichts zu tun hat. Das sind zwei Paar Schuhe. Das eine ist das berechtigte Interesse nach Aufklärung, also die Frage: “Wie schaffe ich den Sprung von meinen Tatsachenbehauptungen zu den daraufhin aufgestellten Regeln.” Eine völlig andere Frage ist aber: “Lässt sich aus der Natur überhaupt eine verbindliche Verhaltensanordnung ableiten?” Wenn “ja” müsste diese Sollensanforderung in der Natur auch dann bestehen, wenn sie nicht gesondert erklärt wird.
Hier ein Beispiel: Die Ehefrau sagt zu Ihnen: “Der Elektriker hat gesagt aus der Wand ragen blanke Drähte, du sollst sie auf keinen Fall angreifen.” David Hume würde bereits an dieser Stelle zusammenzucken: “Der Elektriker stellt einfach einen Tatsachensatz hin und leitet ihn ohne Erklärung in einen Sollensatz über!” Angenommen es sind Starkstromdrähte und sobald sie draufgreifen bekommen sie einen tödlichen Stromschlag. Egal ob ihnen das jemand erklärt oder nicht, wenn sie draufgreifen passiert es so und so. Die Folgen sind also von einer Erklärung unabhängig. Sie sind mit und ohne Erklärung mausetot. Ich kann Ihnen aber jetzt schon sagen Sie werden in beiden Fällen mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht draufgreifen, es sei denn sie sind lebensmüde. Der Grund liegt bereits in der Natur der Sache, den ich Ihnen an dieser Stelle aber nicht erläutern möchte, weil er hier für das Verständnis auch nicht erforderlich ist.
Wichtig zu wissen ist aber das David Hume nicht zwischen einem subjektiven Sollen, also der Moral, und einem objektiven Sollen, also einem in der Natur liegendem Ordnungssystem – ob es jetzt beweisbar ist oder nicht sei dahingestellt – unterscheidet. Das subjektive sollen sind die einzelnen Erwartungshaltungen die Individuen haben. Das objektive Sollen oder Naturrecht, sind die aus natürlichen Tatsachen mit wissenschaftlichen Methoden abgeleiteten Regeln, die eben das uns umgebende natürliche Ordnungssystem repräsentieren. Dieses objektive Sollen darf aber nicht mit subjektiven moralischen Werten verfälscht werden.
Was fällt auf wenn wir nochmals den Text von David Hume ansehen. Er schreibt: “In jedem Moralsystem das mir bisher vorkam habe ich immer bemerkt, dass der Verfasser eine Zeitlang in der gewohnten Betrachtungsweise vorgeht, das Dasein Gottes feststellt oder Beobachtungen über menschliche Dinge vorbringt.” (Quelle: David Hume in Traktat über die menschliche Natur)
David Hume beschreibt hier ein von bewiesenen Fakten losgelöstes mit subjektiven Werten durchtränktes Moralsystem. Das erkennt man alleine daran, dass er davon spricht, dass das Dasein Gottes festgestellt worden sei. In welcher naturwissenschaftlichen Disziplin wurde bisher aber die Existenz Gottes bewiesen? Meines Wissens in keiner einzigen. Damit kann ich aber auch aus einem Sein kein Sollen ableiten, sondern aus Fiktionen bloße Moralvorstellungen. So gesehen können die geforderten Erklärungen allenfalls als Diskussionsgrundlage dienen, weil sie zur Überprüfung einer ordnungsgemäßen Ableitung aus Fakten eben nicht geeignet sind. Wenn man über David Humes Philosophie diskutiert, befindet man sich immer auf einer nicht-wissenschaftlichen moralischen Ebene. David Hume möchte in seiner Moralphilosophie klarmachen dass sich ein Sollen erst durch die subjektive Stellungnahme, also durch die Wertung eines Menschen ergibt, den Beweis, dass es ein objektives Sollen nicht gibt, kann er allerdings nicht erbringen. Edward Moore baut seinen “Naturalistischen Fehlschluss” auf der unwissenschaftlichen moralischen Ebene von Hume auf und wir wissen wenn wir ein Gebäude auf einem schwachen Fundament bauen, dann fällt dieses sehr leicht zusammen. Und das beginnt schon damit, dass Moore den Begriff “Gut” als dein absoluten Maßstab seiner Ethik auserkort. Damit begibt es sich gleich vorweg auf die subjektive moralphilosophische Ebene von David Hume. Aber, woran erkennt man das? Lauschen wir zunächst den Ausführungen von Gerd Scobel:
“Eine wichtige Rolle spielt dabei das sogenannte Argument der offenen Frage, das erst G. E. Moore entwickelt hat. Mit ihm schreibt er Humes ursprüngliche Idee fort und erweitert sie.” […] “Moores Argument zufolge kann man aber genau nicht genau wissen was gut ist, anders als beim Junggesellen-Beispiel. Diese selbstbezügliche Frage nach dem Gutsein des Guten ‘Aber ist das auch wirklich gut?’, diese Frage ist offensichtlich anders, als bei der Junggesellenfrage durchaus sinnvoll. Man kann die Frage nach dem Guten also trotz einer Definition des Guten sinnvoll stellen.” (Quelle: Gerd Scobel auf https://www.youtube.com/watch?v=R2mOmL7D7HQ)
Die Gelehrten meinen also, dass das Gute so komplex sei, dass es keine einfache Definition dafür gäbe, es bleibe daher immer eine offene Frage übrig, die besagt: “Aber ist das was du behauptest wirklich gut?” Wir haben aber festgestellt, dass der naturalistische Fehlschluss von Moore auf der subjektiven Ebene von Hume aufbaut. Daher ist der Fehler in seiner Philosophie auch relativ einfach zu erkennen und das werden wir mit dem folgenden Beispiel tun. Denken wir an eine Küchenarbeitsplatte. Diese fühlt sich bei etwa 20 Grad Celsius Umgebungstemperatur relativ kühl an. Wärme ich mir eine Suppe auf 50 Grad, dann ist sie schon schön warm. Bringe ich das Wasser zum Kochen, werde ich merken dass der Topf bei 100 Grad Celsius schon heiß wird. Die aufgedrehte Herdplatte ist mit Temperaturen bis zu 600 Grad Celsius dann schon sehr heiß. SWR-Wissen bezeichnet in einem Artikel die Oberflächentemperatur der Sonne als kühl. “Aber ist sie wirklich kühl?” – Sie verstehen das Argument der offenen Frage? Mit unserer bisherigen Methode würde dies bedeuten, dass die Oberflächentemperatur der Sonne bei etwa 20 Grad Celsius betragen würde, denn wir haben unsere Küchenarbeitsplatte ja ebenfalls als kühl bezeichnet. Aber wie kann SWR-Wissen nur den Fehler machen und die Oberflächen Temperatur der Sonne als kühl bezeichnen? Ganz einfach, sie haben die Oberflächentemperatur des Sonne mit ihrer Innentemperatur in Relation gestellt und verglichen. Und die Innentemperatur liegt bei 15 Millionen Grad Celsius und ehrlich gesagt, in diesem Verhältnis ist die Oberflächentemperatur der Sonne nun wirklich relativ kühl. Und hier schließt sich der Kreis “Gut” und “Böse”, “Warm und Kalt”, “Lang und Kurz” sind relative Begriffe, die das jeweilige Individuum in bestimmter Relation beurteilt. Ich beurteile etwas indem ich einen individuellen, einen persönlichen Bezug, herstelle.
Ich kann aus Begriffen die dazu dienen subjektive Stellungnahmen abzugeben, keine objektive Wahrheiten aus Tatsachen ableiten. Wenn ich das Geweih eines Hirschkäfers als lang bezeichne, dann lässt die Aussage natürlich die Frage zu: “Aber ist das Geweihe des Hirschkäfers wirklich lang?” In Relation zu einem echten Hirschen ist es natürlich kurz. Wenn ich aber eine objektive Aussage tätige wie: “Das Geweih des Hirschkäfers ist 1,7 cm lang,” und jemand fragt: “Aber ist das Geweih des Hirschkäfers wirklich 1,7 cm lang”, dann kann man sagen: “schnapp dir ein Maßband und miss nach.” Das ist der Unterschied zwischen den unwissenschaftlichen Moral-Ebenen von Hume und Moore und der objektiven wissenschaftlichen Ebene. “Gut” und “Böse” sind Begriffe die erst durch das Individuum selbst definiert werden, genauso wie “Warm” oder “Kalt”, deshalb sind sie relativ und können immer sinnvoll hinterfragt werden. Moores Methode ist daher nicht geeignet den Schluss zu ziehen, dass aus Fakten kein Sollen abgeleitet werden könne, er verwendet ja eine voreingenommene Methode, die nur auf der moralischen Ebene funktioniert. Aus Fakten muss ein objektives, ein absolutes Sollen abgeleitet werden, aber doch kein subjektives. Das ist auch der Fehler den David Hume begeht, wenn er seinen subjektiven Maßstab an die Natur anlegt.
Wir haben also festgestellt, dass Moores Methode gar nicht dazu geeignet war, die Ethik auf eine subjektiv moralische Ebene zu beschränken, sondern dafür konzipiert war, nur auf dieser (moralischen) Ebene zu funktionieren.
Es scheitert aber nicht nur an der Methode, sondern auch am Erkenntnis-Gegenstand. Woraus schöpfen Hume und Moore ihre Erkenntnis? Was ist ihr wissenschaftlicher Gegenstand? Ihr Untersuchungsgegenstand und somit die Quelle ihrer Erkenntnis, sind ihre eigenen Gedanken und ihre Methode ist ihre Sprachanalyse. Das ist das eigentliche Problem. Philosophen neigen dazu, allgemein verbindliche Regeln aus ihren eigenen subjektiven Wertvorstellungen abzuleiten. Dabei gehen sie sogar soweit, dass sie der Natur absprechen für sie verbindliche Regeln vorzusehen. Damit stellen sie sich aber gegen ihre eigene Natur.
Aber selbst diejenigen die gerade noch davon berichten, dass es ein Fehler sei den naturalistischen Fehlschluss zu begehen, machen im selben Atemzug genau diesen Fehler:
“Genau dasselbe wäre der Fall, wenn ich das Gute bestimme, als das was z.B wohltuend ist. Woher weiß ich, dass das was wohltuend ist, tatsächlich auch gut ist? Es könnte mich ja zum Beispiel etwas in einen wohltuenden aber dafür tödlich endenden Schlaf fallen lassen.” (Quelle: Gerd Scobel auf https://www.youtube.com/watch?v=R2mOmL7D7HQ)
Soll man nicht in einen wohltuenden aber tödlichen Schlaf verfallen? Offenbar ist diese Aussage selbsterklärend. Instinktiv ging man davon aus, dass allein aus dem Sachverhalt erkennbar ist, dass das Ertrinken in der Badewanne nicht wünschenswert ist. Oft genug gibt sich die negative Wertung bereits aus der Natur der Sache. Ähnlich wie im nächsten Beispiel:
“Sie sind Arzt oder Ärztin, kommen neu an ein Krankenhaus und jemand sagt zu Ihnen: ‘Wenn du den Patienten die blaue Lösung gibst, bringst du ihn um.’ A = Q. A (blaue Lösung geben) = Q (tödlich). Also darfst du ihm keinesfalls die blaue Lösung geben. A (blaue Lösung geben) ist – in diesem Fall – ‘Schlecht’. Der Schluss ist ja einigermaßen nachvollziehbar. Vorausgesetzt ist offenbar nur eine weitere Prämisse, nämlich dass man seine Patienten nicht umbringen soll. Also Q (Patienten töten) = ‘Böse’. Diese Prämisse ist im vorliegenden Kontext ziemlich trivial, deshalb muss sie wohl kaum explizit benannt werden, aber wenn sie darauf bestehen würde ihr Chefarzt diese oberste Prämisse auch noch nachliefern und damit den Schluss vollständig und korrekt machen.” (Quelle: Dietmar Hübner auf https://www.youtube.com/watch?v=zt1V-MC4PeY&t=33s)
Auch hier gibt Professor Hübner schon zu erkennen, dass sich die Lösung bereits aus der Natur der Sache ergibt und nur der Vollständigkeit halber man die oberste Prämisse nachreichen könne. Was ist aber die Folge wenn der Arzt die Prämisse nachreicht indem er sagt: “Wir sollen die Patienten töten!” und damit dem natürlichen empfinden widerspricht? Die Natur der Sache ist in diesem Fall ja nur ein Gefühl, aber: Wie muss ich den Erkenntnis-Gegenstand wählen, wenn ich aus der Natur tatsächlich objektive Normen ableiten möchte? Und welche Wirkung hat das im Gegensatz zur willkürlichen Anordnung des Arztes, die Patienten zu töten? Dazu muss man jedenfalls die moralische Ebene von Hume und Moore verlassen und direkt aus der natürlichen Umwelt jene Erkenntnisse gewinnen, die für das Entdecken der natürlichen Ordnung erforderlich sind.
Wenn Sie mehr über die Gewinnung von Naturrecht und die richtige Wahl des Erkenntnis-Gegenstandes wissen wollen, dann darf ich Ihnen mein Buch empfehlen: “ODIRON – Leben nach den Regeln der Natur” oder abonnieren Sie einfach meinen YouTube-Kanal. Ich danke Ihnen an dieser Stelle herzlich fürs Zusehen, tschüss und bis zum nächsten Mal.