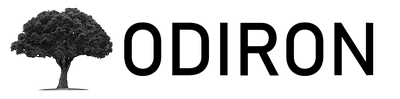Der Beweis für Naturrecht
Schritt für Schritt von natürlichen Tatsachen zum Naturrecht. Erkennen sie den Zusammenhang zwischen den Regeln der Natur und einem ausgeglichenen und zufriedenen Leben.
Odiron ist eine urheberrechtlich geschützte Marke.
*Mit dem Kauf akzeptierst du unsere Rücksendebestimmungen und Datenschutzbestimmungen.
Was ist der Kern des Problems und was ist die Lösung?
Die Fragestellung
Gibt es ein absolutes, höheres Regelwerk, welches nicht nur beweisbar ist, sondern auch alle Menschen gleichermaßen berechtigt und verpflichtet? Können wir dieses Regelwerk erkennen und uns seiner Missachtung bewusst werden? Was geschieht, wenn wir es missachten? Wie sollte der einzelne Mensch denken und sich verhalten, um naturrechtskonform leben zu können?
Erkenne das Problem
Soweit man die schriftlichen Aufzeichnungen der Menschheitsgeschichte zurückverfolgen kann, beschäftigte sich der Mensch mit den Themen »Recht« und »Gerechtigkeit«. Bevor die Wissenschaftlichkeit in der Juristerei Einzug gehalten hatte, gingen die Rechtsgelehrten davon aus, dass der Mensch an vorgegebene natürliche oder göttliche Regelungen gebunden sei. Obwohl man diese nicht beweisen konnte, thronten solche Normen jahrhundertelang als unerreichbare Konstanten an der Spitze unterschiedlicher philosophischer Konstruktionen und schienen gegenüber jeder kritischen Hinterfragung immun zu sein.
Erst mit der Trennung von »Sein« und »Sollen« (vergl. Das »Humesche Gesetz« von D. Hume bzw. den »Naturalistischen Fehlschluss« von G. E. Moore) und der darauf fußenden Rechtslehre der (konsequenten) Rechtspositivisten, wurde diesem Treiben ein vorläufiges Ende bereitet.
Das Streben nach Wissenschaftlichkeit forderte einen »wissenschaftlichen Gegenstand« von dem man mit geeigneten Methoden intersubjektiv nachprüfbare Aussagen ableiten konnte. Ganz im Sinne des »Relativismus« war man der Auffassung, dass »Absolute Normen«, welche zu jeder Zeit und an jedem Ort Gültigkeit hätten, nicht bewiesen werden könnten. Den »Willen der Natur« oder den »Willen Gottes« konnte man mit wissenschaftlichen Methoden eben nicht ergründen.
Nicht weil es »richtig« war, sondern weil es »zweckmäßig« erschien, wählte man als Gegenstand der Rechtswissenschaft das »Positive Recht«, also das von Staaten nach einer bestimmten »Erzeugerregel« niedergeschriebene und kundgemachte Recht. Mit dem geschriebenen Recht wählte man sozusagen eine »Rechtsquelle« die nicht nur für jedermann erkennbar, sondern auch effektiv war. Sie galt deswegen als effektiv, weil sie von einem Machthaber durchgesetzt wurde und gegenwärtig auch immer noch wird.
Nach der Lehre des Rechtspositivismus holt sich das »Positive Recht« seine Legitimität aus der »Grundnorm«. Diese ist somit seine höchste Legitimitätsbasis. Die Grundnorm selbst ist aber eine bloße »Denkvoraussetzung« in der nichts Anderes hineingedacht werden sollte als: „Wenn in einer Gemeinschaft ein höchster Gewalthaber vorhanden ist, soll, was er anordnet, befolgt werden“ (G. Radbruch). Die gesamte rechtspositivistische Lehre fußt also auf einer »Fiktion«, die dem höchsten Machthaber in einer Gemeinschaft, das ist in der Regel der staatliche Souverän, eine vollständige inhaltliche Regelkompetenz zukommen lässt.
Diese schrankenlose Regelkompetenz wurde im Rahmen der »nationalsozialistischen Herrschaft« umfangreich ausgeschöpft und missbraucht. Auch wenn sich G. Radbruch nach dem Zweiten Weltkrieg bemühte, die Rechtlosigkeit das nationalsozialistischen Regelwerkes hervorzustreichen, so zeigte sich doch deutlich, dass die rechtspositivistische Lehre dazu geeignet ist, jedem noch so menschenverachtenden Regime eine sichere Rechtsbasis zu verleihen.
Diese Erkenntnis bewegte nach dem Zweiten Weltkrieg auch den rechtspositivisten G. Radbruch zu einem teilweisen Umdenken. Nach der von ihm formulierten sogenannten »Radbruchschen Formel«, sollten nunmehr Gesetze ihre Gültigkeit verlieren, wenn sie »unerträglich ungerecht« sind. Damit korrigierte er die rechtspositivistische Lehre mit einer »naturrechtlichen Notbremse«, um sogenannte unerträgliche Ungerechtigkeiten durch einen Machthaber zu vermeiden.[1]
Das ist insofern interessant, da ja gerade der »Relativismus« die Rechtfertigung für den Rechtspositivismus war. Absolute Normen galten ja als nicht nachweisbar und schon alleine die Wissenschaftlichkeit schien einen Gegenstand zu fordern, der sich von jeder Spekulation verabschiedete. Nun aber möchte Radbruch, dass sich der vom Rechtspositivismus mit unbeschränkter Gesetzgebungskompetenz gesegnete Machthaber einer »naturrechtlichen Legitimitätsprüfung« unterzieht. Damit macht er die Gültigkeit von Gesetzen wiederum von nicht nachweisbaren absoluten Normen abhängig. Aber auch wenn diese Regel vielleicht nur auf extreme gesetzliche Ausreißer anzuwenden ist, so ist sie trotzdem fixer Bestandteil und damit naturrechtliches Prinzip jener Rechtsordnungen, die sie anwenden.
Diese, im Zeichen absoluter Systemwidrigkeit und Hilflosigkeit zusammengesetzte, Konstellation hat demnach nicht den Namen »Radbruchsche Formel«, sondern eher den Namen »Radbruchsches Paradoxon« verdient.
Mit dem »Radbruchschen Paradoxon« sind wir in der rechtswissenschaftlichen und rechtsphilosophischen Gegenwart angelangt. Es herrschen zwei völlig inkompatible Rechtsgeltungsphilosophien vor, an deren gedanklichen Fundamenten jeweils »Fiktionen« thronen.
Der einzige Lichtblick in diesem Legitimitätschaos ist das in manchen Staaten vorherrschende »demokratische Prinzip«. Demnach können Staaten bis zu einem gewissen Grad ihre Legitimität aus der Zustimmung ihrer Normunterworfenen ableiten (Anerkennungstheorie). Aber auch die Anerkennungstheorie ist zurecht strittig, sind doch ihre Schwächen evident und nachvollziehbar. So gibt es beispielsweise keine objektiv nachvollziehbare Rechtfertigung dafür, warum die Mehrheit einer Gemeinschaft einer Minderheit ihren Willen aufzwingen dürfe. Wenn jeder Mensch gleich sein solle, müsse man eine höhere Legitimation finden, um andere gegen ihren Willen zu irgendetwas verpflichten zu dürfen. Mehrheitsentscheidungen sind demnach zwar praktikabler, ein Recht über andere zu bestimmen, kann alleine daraus unter gleichwertigen Menschen aber nicht abgeleitet werden.
Auch wenn sich gegenwärtig die Legitimität von staatlichen Verfassungen von Staat zu Staat unterscheiden, so lassen sie sich auf einige wenige Prinzipien herunterbrechen. Entweder man beruft sich auf:
- nicht beweisbares höheres Recht (vgl. etwa religiöse Dogmen in Gottesstaaten),
- auf die willkürliche (rechtspositivistische) Normsetzungsbefugnis des Staates (vgl. Diktaturen) oder
- auf die Zustimmung der Normunterworfenen (z.B. Vertrags- oder Anerkennungstheorie | vgl. direkte Demokratie).
Für viele Menschen stellt sich die Frage nach der »Legitimität eines Staates« erst dann, wenn sie gegen ihren Willen zu irgendetwas gezwungen werden oder wenn der Staat seine Macht offenkundig missbraucht. Gerade mit dem Phänomen der sogenannten »Staatsverweigerer« zeigt sich, wie wichtig ein fundamentiertes Wissen über die Legitimität eines Staates sein kann. Hier war und ist auffällig, wie wenig Aufklärung und Prävention von staatlicher Seite geleistet wird und wie fest sich die Staaten an das bloße Faktum »Macht« klammern. Zum Teil kann man natürlich auch die Meinung vertreten, dass die herkömmlichen Erklärungsmodelle gar nicht dafür geeignet sind Kritiker von deren Richtigkeit zu überzeugen. Weder die Legitimitätsbasis des »Rechtspositivismus« noch des »Naturrechts« kann nachgewiesen werden. Auf umfangreichere Mittel einer demokratischen Legitimation (etwa in Form von bindenden Volksabstimmungen) greifen staatliche Regierungen meist erst dann zurück, wenn von rechtsstaatlicher Seite her keine andere Wahl bleibt oder ihnen das Ergebnis aller Voraussicht nach auch in die Hände spielen wird. Ist der Ausgang eines Referendums oder einer sonstigen demokratischen Wahl ungewiss, setzen die Machthaber alles daran, um mit massiver (Medien)-Propaganda den Willen des Volkes in die gewünschte Richtung zu lenken.
Zusammenfassend kann man daher festhalten, dass man nach wie vor rechtswissenschaftlich als auch realpolitisch vom »Recht« im Sinne einer »absoluten Gerechtigkeitsordnung« meilenweit entfernt ist.
Es soll hier aber nicht unerwähnt bleiben, dass auch alle von den sogenannten »Staatsverweigerern« ins Treffen geführten Rechts- und Legitimitätsbekundungen völlig wirr aus der Luft gegriffen werden und daher jeder fundierten Grundlage entbehren.
Was ist die »Quelle des Rechts«?
Die Rechtswissenschaft (aber auch andere Geisteswissenschaften, wie etwa die Bildungswissenschaften) stehen vor dem großen Problem, dass sie ihren wissenschaftlichen Gegenstand nicht oder nicht richtig positioniert bzw. definiert haben. Das führt dazu, dass sie entweder aus dem luftleeren Raum oder auf falscher Grundlage ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse gewinnen. Wissenschaftliche Diskurse werden aufgrund dieses Umstandes zum Teil auf fast peinlichen Nebenschauplätzen ausgetragen, während man in den Hauptfragen völlig im Dunklen tappt (So ist die Diskussion über das »Sein/Sollen«-Problem bei Hume bzw. Moore nicht im Entferntesten dazu geeignet irgendwelche Aussagen darüber zu treffen, ob es nun tatsächlich »absolute Normen« in der Natur geben könnte und wie sie sich allenfalls objektivieren ließen).
Die Folge des falschen Wählens eines wissenschaftlichen Gegenstandes ist, dass die daraus methodisch abgeleiteten wissenschaftlichen Erkenntnisse meist auch unrichtig sind.
Für die Rechtswissenschaften (aber auch für die Bildungswissenschaften und andere Geisteswissenschaften) ist daher die richtige Wahl des wissenschaftlichen Gegenstandes essentiell. Es muss sich intersubjektiv nachweisbar um die »richtige Basis« handeln, aus der sodann methodisch die entsprechenden Erkenntnisse gewonnen werden.
Daraus ergibt sich die erste große Frage mit der sich das gegenständliche Buch beschäftigt:
»Gibt es einen wissenschaftlichen Gegenstand aus dem mit Hilfe der menschlichen Vernunft objektiv erkennbare Regeln abgeleitet werden können und die dem Menschen bzw. anderen Lebensformen vorgegeben sind?«
Dieser Gegenstand kann natürlich nicht die menschliche Vernunft selbst sein, da sich diese einerseits bei jedem Individuum unterscheidet und andererseits wäre es vermessen zu versuchen, bloß aus der menschlichen Vernunft solche Regeln abzuleiten, wo sie doch dem Menschen übergeordnet sein sollten.
Würde dieser essentielle wissenschaftliche Gegenstand gefunden werden und sich daraus »objektive Verhaltensanordnungen« ableiten lassen, würden diese das gesamte Spektrum der menschlichen Regelwerke betreffen. Dies hat nicht nur Auswirkungen auf die Rechtswissenschaften, sondern auch auf die Sozial- oder Bildungswissenschaften. Plötzlich gäbe es eine »objektiv nachvollziehbare Basis« auf der all diese Regeln aufgebaut werden müssten. Die menschliche Willkür würde dadurch begrenzt werden, weil sie in einen intersubjektiv nachvollziehbaren »naturrechtlichen Rahmen« eingebettet wäre.
Aber: Kann man so einen objektiven wissenschaftlichen Gegenstand überhaupt erkennen und naturrechtliche Normen daraus ableiten?
Die Lösung
Ja! Mit Hilfe der menschlichen Vernunft lässt sich ein objektiv erkennbarer wissenschaftlicher Gegenstand feststellen, aus dem intersubjektiv nachweisbar »reine naturrechtliche Normen« abgeleitet werden können.
Das bedeutet:
Man kann aus natürlichen Tatsachen (aus einem »Sein«) Verhaltensnormen (ein »Sollen«) ableiten, sodass für jedermann intersubjektiv nachvollzogen werden kann, dass es sich dabei um den »Willen der Natur« (sofern man dies so bezeichnen möchte) und somit um Normen handeln muss, die zu jeder Zeit und an jedem Ort – unabhängig von Gesellschaft und Kultur – Geltung haben müssen.
- Radbruch meinte zwar: „Wäre nun richtiges Recht, gleichviel ob Naturrecht alten Stils oder Naturrecht mit wechselndem Inhalt, entgegen der relativistischen Auffassung eindeutig erkennbar, so wäre der Schluss unvermeidlich, daß von ihm abweichende Satzung vor ihm erbleichen müßte wie der entlarvte Irrtum vor der enthüllten Wahrheit.“ [2]
De Facto sollte man dies etwas bescheidener sehen. Auch wenn mit diesem Buch erstmals eine intersubjektiv nachvollziehbare Methode geliefert wird, wie »reines Naturrecht« abgeleitet werden kann, so dient es in erster Linie als Argumentationshilfe und Mittel zur Bewusstseinsbildung. Eine weitreichende Anerkennung und Umsetzung wird mit einer entsprechenden Bewusstseinsbildung wohl erst nach und nach einsetzen können.
Jedenfalls gab es bisher noch niemanden der in natürlichen Tatsachen einen normativen Gehalt nachweisen konnte. Aus diesem Grund wird »immer« jener die besseren Argumente haben, der seine Aussagen mit Fakten belegen kann und nicht aus »Denkvoraussetzungen« (vergl. Grundnorm) bzw. »Gedankenexperimenten« (vergl. Naturzustand) herleitet oder die Regelunterworfenen auffordert, an das Bestehen einer Ordnung einfach »Glauben« zu müssen (vergl. Religionen).
[1] An dieser Stelle soll der Vollständigkeit halber darauf hingewiesen werden, dass sich die konsequenten Rechtspositivisten sehr wohl von der Lehre Gustav Radbruchs etwas distanzieren. Sie werfen ihm auch vor, dass er bereits vor dem Zweiten Weltkrieg eine gewisse Affinität zum »Werteobjektivismus« gehabt hatte (vergl. Dreier Horst, Seite 128-130).
[2] Radbruch, Seite 22.